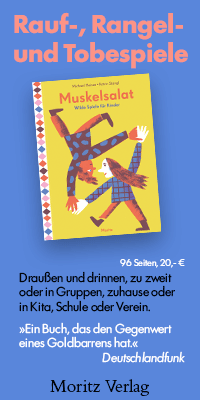|
Mit der Gender-Forscherin Prof. Dr. Maureen Maisha Eggers sprach Barbara Leitner.
Erziehen wir Kinder zu Hause wie in Kindergarten und Schule nach veralteten Stereotypen?
Ja, wir vereinseitigen Kinder. Unsere Erziehung geht von einer Geschlechterdifferenz aus. Sowohl durch Materialien als auch die Sprache teilen wir Kindern mit, es würde zwischen Mädchen und Jungen eine Differenz geben. Sie selbst sortieren sich dann nach den vermittelten Unterschieden. Das fängt sehr früh an. Spätestens mit drei Jahren sind Kinder in das verstrickt, was wir doing difference nennen.
Das sind banale Sachen: Mädchen haben lange Haare, Jungen kurze. Dazu sehen sie im Alltag, welche Berufe Frauen ausüben und welche Männer. Sie nehmen wahr, dass Männer eher die Handelnden sind, Frauen die dazugehörige Ausstattung. Das ist allerdings ein sehr enges Konzept.
Ich gehe eher davon aus, dass die Anlagen von Menschen gestreut sind. Unabhängig von ihrem Geschlecht sind Menschen beispielsweise unterschiedlich draufgängerisch oder nachdenklich. Durch die Erziehung aber legen wir bereits sehr kleinen Kindern nahe, bestimmte Attribute würden eher zu Mädchen und andere eher zu Jungen gehören.
Welche Folgen hat das für Jungen?
Bereits bei kleinen Jungen wird der Wunsch zurückgedrängt, sich selbst zu verschönern. Als Vier-, Fünfjährige können sie nicht mehr mit einem Rock in die Kita kommen oder sich schminken. Das ist höchstens im Rollerspiel akzeptiert. Statt mit Puppen zu spielen, wird ihnen von ihrer Umgebung nahe gelegt, Actionfiguren zu wählen. Schnell heißt es von Gleichaltrigen oder Erwachsenen: »Es ist komisch, dass du mit Puppen spielst.« Die Fähigkeit, andere zu versorgen wird ihnen abtrainiert, obwohl wir davon ausgehen können, auch Jungen hätten Freude daran.
Was passiert bei den Mädchen?
Analysen aus der Geschlechterforschung zeigen einen auffallend verschwommenen Blick auf Mädchen. Werden beispielsweise professionell Erziehende gefragt, welche Spielinteressen sie bei Mädchen wahrnehmen, was Mädchen spielen und mit welcher Absicht, können sie oft nur allgemeine Aussagen treffen: Das Mädchen spielt gern in der Puppenecke. Bei Jungen hingegen wissen sie, wie viele Mitspieler einbezogen werden, wer das ist und welche Rolle ein bestimmter Junge übernimmt, ob er Chef ist oder Ideengeber.
Hat dieser Befund etwas mit der Wahrnehmung der eigenen Rolle als Frau zu tun?
Vermutlich eher mit unserer Sozialisation. Als eine Person, die auch weiblich vergesellschaftet wurde, reflektierte ich meine eigene Lehrtätigkeit.
Von Schulklassen wird beispielsweise berichtet, dass die Pädagogen die Namen von Jungen besser aufrufen können und Mädchen eher als einer bestimmten Gruppe zugehörig verorten. Dabei melden sich Mädchen häufiger. Ihre Beiträge werden oft als Allgemeinwissen behandelt: »Danke, das wissen wir.« Wenn sich Jungen melden, wird das an sie persönlich gebunden. »Wie David richtig sagte…«
So etwas kann man auch in Talkrunden beobachten. Frauen statten diese Runden eher aus, formulieren ihre Beiträge eher als Frage oder haben einen Einwurf. Männer dagegen entwickeln oft ihre Argumentationen von A bis Z und bekommen auch von Talkmasterinnen die Erlaubnis dazu.
In dieser Einschätzung finde ich mich als Lehrende auch selbst wieder. Auch ich nenne männliche Studierende – in meinem Studiengang die Minderheit – eher beim Namen. Junge Frauen melden sich oft mit einem Zweifel, sind unsicher, ob das Gesagte wissenschaftlich sei, und ich nutze meine Antwort seltener, um sie aufzuwerten. Heute bemühe ich mich bewusst, das zu tun.
Was bedeutet diese Rückmeldung für das Selbstbild von Mädchen und Jungen?
Wenn Jungen selbst für eine mittelmäßige Leistung ein personifiziertes Feed back bekommen, lässt es sie großartig erscheinen. Mädchen hingegen kriegen, selbst wenn sie eine gute Leistung vorweisen können, nur ein allgemeine Rückmeldung. Da müssen wir uns nicht wundern, dass es für viele Mädchen zentral ist, an sich zu zweifeln. Sie können ihre Leistung nicht in ihr Selbstbild übernehmen. Das führt langfristig dazu, dass sie sich nicht so gut entwickeln.
Darüber sprach ich auch mit meinen Studierenden: Wie verschieden es ist, ob man sechs Semester eher allgemein angesprochen wird, ob die Aussage als Allgemeinwissen gewertet wird oder ob das Wissen immer an die Person gekoppelt wird. Für sie war klar, dass die zweite Variante hilft, sich als kompetent zu begreifen, die erste weniger. Das heißt: Wir haben zwar Menschen in der gleichen Lebenssituation, befähigen sie aber unterschiedlich.